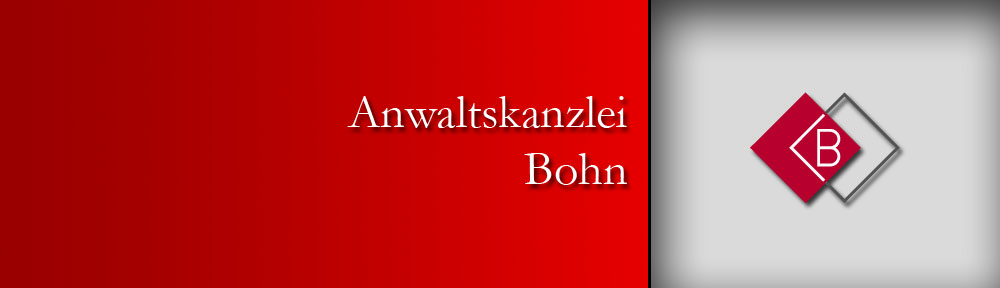Im Falle einer Trennung oder Scheidung stellen sich vor allem bei Männern / Vätern folgende Fragen: „Bin ich überhaupt der biogische Vater des Kindes? Wie oft werde ich mein Kind nach der Trennung sehen dürfen? Darf mir die Mutter des Kindes den Umgang mit meinem Kind verbieten? Muss ich Unterhalt bezahlen und falls ja in welcher Höhe?“
Vater im Sinne des Gesetzes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Bestehen begründete Zweifel an einer Vaterschaft, kann man diese beim zuständigen Familiengericht anfechten. Allerdings ist eine Vaterschaftsanfechtung normalerweise maximal zwei Jahre nach Kenntnis der Gründe möglich.
Nach Klärung der Vaterschaft stellt sich die Frage welche Rechte der Vater nunmehr in Bezug auf das gemeinsame Kind hat.
Miteinander verheiratete Eltern haben auch nach der Trennung bzw. Scheidung grundsätzlich das gemeinsame Sorgerecht. Grundsätzlich darf der eine Elternteil nicht ohne die Zustimmung oder gegen den Willen des anderen Elternteils alleine darüber bestimmen, bei wem und wo die Kinder künftig wohnen werden – oder diese einfach mitnehmen.
Bei nicht miteinander verheirateten Eltern steht der Mutter das alleinige Sorgerecht zu, soweit nicht eine sog. Sorgerechtserklärung beim Jugendamt oder Notar bezüglich der gemeinsamen Sorge abgegeben wurde. Ebenfalls hat der Vater die Möglichkeit im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens die Übertragung des gemeinsamen Sorgerecht zu beantragen.
Unabhängig vom Sorgerecht hat der Vater ein Recht auf den regelmäßigen Umgang mit dem Kind, den ihm die Mutter auch nicht verwehren darf.
Nach einer Trennung bzw. Scheidung kann anhand der Düsseldorfer Tabelle der Unterhaltsbedarf und damit der zu zahlende Unterhalt für das/die gemeinsame(n) Kind(er), das/die nicht im eigenen Haushalt lebt/leben ermittelt werden.
Bei der Düsseldorfer Tabelle handelt es sich um eine bundesweit anerkannte Richtlinie zur Ermittlung des Unterhaltsbedarfes und damit zur Ermittlung des Unterhalts. Der Unterhaltsbedarf ist dabei gestaffelt nach dem unterhaltsrechtlich relevanten Einkommen des Unterhaltspflichtigen und dem Alter des/der unterhaltsberechtigten Kindes/Kinder.
Der Selbstbehalt für einen erwerbstätigen Unterhaltszahler beträgt bis 2014 monatlich 1.000 Euro. Ab dem 1. Januar 2015 ist dieser auf 1.080 Euro gestiegen.
Für einen nicht erwerbstätigen Unterhaltsverpflichteten steigt der notwendige Selbstbehalt ab Januar 2015 von 800 Euro auf 880 Euro im Monat. Hierin sind bis 380 EUR für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt soll erhöht werden, wenn die Wohnkosten (Warmmiete) den ausgewiesenen Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind.
Der angemessene Eigenbedarf gegenüber volljährigen Kindern, beträgt in der Regel mindestens monatlich 1.300 EUR. Darin ist eine Warmmiete bis 480 EUR enthalten.
Sofern das monatliche unterhaltsrechtlich relevante Einkommen der unterhaltspflichtigen Person über 5.100,00 Euro liegt, wird der zu zahlende Unterhaltsbetrag nicht mehr nach der Düsseldorfer Tabelle berechnet, sondern individuell im Einzelfall bestimmt. Soweit Kinder im Ausland leben, gibt es Sonderregelungen die zu einer Änderung des Unterhaltsbetrages führen können.
Kindergeldberechtigt ist der Elternteil in dessen Haushalt das Kind lebt. Soweit das Kind im Haushalt des Vaters lebt ergeben sich hieraus auch entsprechende Steuervorteile sowie die Möglichkeit, dass der Vater nach der Geburt des Kindes einen Anspruch auf Elternzeit hat, soweit er das Kind überwiegend selbst betreut und während der Elternzeit nicht mehr als 30 Wochenstunden arbeitet. Unabhängig vom Recht der Personensorge für das Kind kann auch der nicht verheiratete Vater einen Elterngeldanspruch haben.
Wenn der Anruf aus dem Kindergarten oder der Schule wegen Erkrankung des Kindes kommt, dürfen auch Väter nicht nur früher den Arbeitsplatz verlassen sondern sie haben bei Erkrankung des Kindes ebenfalls die Möglichkeit von der Arbeitspflicht freigestellt zu werden, ohne dass Sie hierdurch Ihre Vergütungsansprüche verlieren.
Zudem haben auch Väter aus familiären Gründen das Recht Ihre Arbeitszeit zu verringern, soweit das Arbeitsverhältnis seit mehr als sechs Monaten besteht und keine betrieblichen Gründe der Verringerung der Arbeitszeit entgegenstehen.
Christiane Bohn, Rechtsanwältin